Rolf-Dieter Spann

Mein Schreiben
Seit ich denken kann, schreibe ich. Na, jedenfalls seit ich das Alphabet gelernt hatte. Schon früh erkannte ich, dass ich alle Dinge ausdrücken kann, indem ich mit den verschiedenen Sinnschattierungen der Sprache spiele. Bereits in den ersten Schuljahren war ich begeisterter Aufsatzschreiber, ganz im Gegensatz zu allen mir bekannten gleichaltrigen Vertretern des männlichen Geschlechtes. Und ich las: Zunächst stapelweise Comic-Hefte, was mir offensichtlich nicht sonderlich geschadet hat. Bald aber schon interessierten mich die tiefen Fragen nach Sinn und Sein. Vom Taschengeld (als Vierzehnjähriger) kaufte ich mir Bücher über Psychologie und Philosophie, studierte die Bibel, spürte dem Sinn des Lebens nach, war auf der Suche nach mir selbst. "Das Leben ein Traum" von Calderon elektrisierte mich, war ich mir doch nicht sicher, dass vieles, was des Tages so daher kam, Realität sein sollte. Ich war ein begeisterter Träumer, aber auch scharfer Beobachter. Im Spiel gab ich meist den Ton an, indem ich meinen Freunden vorgab, wie sich die Rollenspiele entwickeln sollten und im Schullandheim wurde ich im Schlafraum gebeten, selbst erdachte Geschichten zu erzählen. Mein Vater erzählte uns Kindern auch solche, ich führte die Tradition bei meinen jüngeren Geschwistern und später meinen Kindern fort. Lesen, fabulieren und schließlich schreiben bestimmte mein ganzes Leben. Aber erst die langen S-Bahnfahrten als Pendler zwischen Solingen und Düsseldorf brachten die Muße, mich ernsthaft mit Sprache und Gesprochenem auseinanderzusetzen. Immer die Kladde zur Hand, notierte ich über Jahre jeden Einfall, meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen.
Nachdem ich in verschiedenen Medien erfolgreich meine Texte – meist Gedichte – veröffentlicht hatte, mich in Schreibkreisen und Künstlerrunden in Düsseldorf, Remscheid, Wuppertal und Solingen mit anderen ausgetauscht und von ihnen gelernt hatte, begann ich auch eigene Lesungen durchzuführen. 1999 gründete ich "Literarische Treffen in Solingen". Seit 2001 bin ich in Dassel wohnhaft, wo ich mit meiner zweiten Frau Bärbel seither jedes Jahr etliche größere und kleinere Veranstaltungen organisiere.
Veröffentlichungen
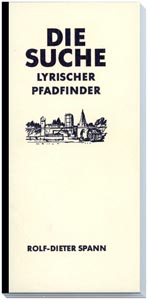
Gedichtband, 1998, Selbstverlag

Prosatexte, 1999 im Selbstverlag

Aphorismen, 1999 im Selbstverlag
1. Auflage
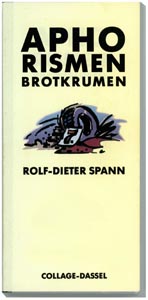
2. erweiterte Auflage Aphorismen, 2004, Selbstverlag
Illustriert mit Werkschau Skulpturen, Grafiken und
Zeichnungen von Rolf-Dieter Spann

Gedichtband, 2006, Collage-Verlag Dassel
ISBN: 3-938357-04-5

Aphorismen-Folder /Leporello, 2-seitig im Schuber,
2004 Collage-Verlag Dassel
Texte gegen Faschismus aus "Aphorismen Brotkrumen", 2004
von Rolf-Dieter Spann


3. erweiterte Auflage, 2010, Vorabdruck Collage Verlag Dassel
Kostproben aus meinen Aphorismen
Wer Anbetungshilfen als Krücken braucht, ist behindert.
Eine moderne Gesellschaft muss auch unmoderne Ansichten ertragen können.
Armut ist keine Schande. Jedenfalls nicht für den Armen.
Prägnanz im Ausdruck muss nicht Sprechfaulheit bedeuten.
Ausgrenzung ist auch Freiheitsentzug – nur in einem größeren Gefängnis.
Gedichte:
1. Gedichte zum Nachdenken
Dichtung
Wer kennt alle Epen, Dramen,
hat sie je gelesen?
Wer nennt mir die wahren Namen,
ihr geheimes Wesen?
Blut und Schmerz fließt in die Tinte
aus der Dichterseele,
aus des Herzens Labyrinthe
singt die Philomele.
Formt selbst Dummheit zur Komödie,
oft zur Farce, zur Posse,
hebt das Finst’re der Tragödie
beispielhaft zur Glosse.
Dichtung überspannt den Graben
zwischen Laster – Tugend,
jedes lässt sie ihres haben,
Reife und auch Jugend.
Malt elysische Visionen
und des Abgrunds Grauen,
wie die Götter eitel thronen,
Menschen auf sie bauen.
Dichtung zeigt den Kern der Dinge
hinter bunten Larven.
Wer berufen ist, der singe
laut zu Äolsharfen.
©9/2000 Rolf-Dieter Spann
Albtraum
Die Nacht, ein Traum,
ein Alb im Raum
mit hässlichem Gesicht.
Die Füße schwer,
das Herz pumpt leer,
die Brust drückt ein Gewicht.
„Nur noch ein Jahr!“
Macht er mir klar,
dann gehts mit mir zuend.
Ich hör mich schrein
in meiner Pein,
erwache nass geflennt.
Der Traum war Schaum!
Ich glaub es kaum:
er ließ mich morgens knien!
Jetzt schau ich oft,
ganz unverhofft,
ob schon die Vögel ziehn.
©9/1996 Rolf-Dieter Spann
Chronos
Tick-tack-tick-tack, ohne Ende
teilt die Uhr die Lebenszeit.
Ob nach hier, nach dort ich wende
meine Augen, meine Hände,
damit wirklich ich was fände…
stetig fließt dahin die Zeit.
Während Zeiger um die Mitte
kreisend schneiden von der Zeit,
scheint es, dass die Zeit beschnitte
alles Tun – und es entglitte;
Fortschritt macht ganz kleine Schritte.
Eilig fließt dahin die Zeit..
Stunden, Tage sich summieren,
Jahre sind noch kurze Zeit.
Um das Leben recht zu spüren,
ohne Hast sein Werk zu führen,
auch was Neues zu probieren,
fließt zu schnell dahin die Zeit.
Wohin strömen all die Stunden,
die uns gab und nahm die Zeit?
In vieltausend Jahresrunden
niemand hat den Pfuhl gefunden,
wo verbrauchte Zeit gebunden.
Ewig fließt dahin die Zeit.
©8/1998 Rolf-Dieter Spann
Das Leben ist kein Traum
Du sagst, das Leben sei ein Traum –
ich glaub es kaum.
Denn, käme nach so langer Nacht
nicht endlich Licht, ein gutes Ende?
Und Menschen reichten sich die Hände,
missbrauchten nicht mehr ihre Macht?
Mag sein, es gibt nicht nur die Not
und Hass und Tod –
doch wär die Welt ein Traumgesicht,
dann müsste auch das ganze Bluten
der aufgepeitschten Menschenfluten,
zu bannen sein, in ein Gedicht.
Das Leben ist stets wahr und jetzt,
auch wenns entsetzt.
Doch liegt darin der Hoffnungskeim,
dass wir tatsächlich klüger werden
und Friede herrscht einmal auf Erden,
dann träumt ich gern und wär daheim.
©1/1999 Rolf-Dieter Spann
Das Brot der Erde
Mit starker Hand und Heimatsinn
ein Mensch sät in die braune Erde,
das Korn, das schon im Keim mutiert,
damit es blond und edel werde,
dass starke Halme wie ein Meer
das Tal, die ganze Welt bedecken,
sich biegen lassen im Konzert
und ihre Köpfe aufwärts recken.
Die Frucht, so denkt er, ist zum Heil.
Es stärken sich an ihrem Wesen
die schwachen Menschen überall,
das Kranke soll daran genesen.
So wächst das Korn so prall und schön
in Reih und Glied, gleich einem Heere.
Wo früher Blumen, Gräser, Kraut
gestanden, steht nunmehr die Ähre.
Die Saat geht auf, es naht der Tag,
an dem die ganze Welt erkenne,
was Großes hier der Mensch erschafft,
welch neue Frucht erfüllt die Tenne.
Die Zeit ist da, man drischt das Korn.
Doch als man Spelzen, Stroh entfernte,
hat braunes Gift und schwarzer Pilz
verdorben diese ganze Ernte.
Statt grüner Revolution,
Erträgen, die der Welt zum Segen,
berauscht letales Mutterkorn
den Konsument', den dummen, trägen.
Wenn auch ein Mensch sich göttlich wähnt,
zu schaffen den Homunkulus,
so ist das Ende immer gleich:
er bringt der Welt statt Glück Verdruss.
©7/2000 Rolf-Dieter Spann
Der Asylant
Als du dein Leben bargst vor Folter, Krieg und Tod,
vertrautest Menschlichkeit in einem fernen Lande,
bestiegst dann voller Angst ein halb verfallnes Boot
und gabst das Letzte her für eine Schlepperbande.
Die Narben auf der Haut hast du nicht mehr gezählt,
verdrängst den tiefen Hass auf die, die das begangen.
Nur dumpfer heißer Schmerz brennt, wenn man Leben wählt,
man bleibt, wohin man geht, in alter Angst gefangen.
Du, der in bittrer Not, vertrieben und verarmt,
in fremde Länder schlichst, bist Spross des Lebensbaumes.
Dein Herz wird dir zu eng, weil niemand sich erbarmt,
Dein Herz, das andren schlug, harrt sehnsüchtig des Traumes:
Du sehnst dich nach dem Ort, der nicht nur Boden war.
Die Wurzeln blieben dort, als man dich abgehauen.
Wenn einmal Regen fällt, sprießt’s wieder, wunderbar.
Das ist es, was dich hält, darauf willst du vertrauen.
©3/1999 Rolf-Dieter Spann
Die Oderflut
Dunkel tanzen die Gespenster
lang vergess’ner großer Fluten
vor dem regennassen Fenster.
„Fort nur, fort!“ Hört man sie heulen.
Aufgebrochene Wunden bluten.
Grauschwarz droht der Wolkenhimmel.
Böse schmatzend fließt die Oder.
Nah im Dorfe warnt die Bimmel.
Sandsackbarrikaden stützen
Dämme, puddingweich wie Moder.
Stiefel kneten Schlamm auf Wegen,
Seen bilden sich am Boden.
Helfer karren Sand auf Stegen.
Andernorts wär Regen Segen,
doch bei Deichen, solch maroden?
Sorgenvolle Augen starren
auf den Pegelstand des Flusses.
Hab und Gut wirft man auf Karren,
dichtet provisorisch Häuser.
Ist bald Ende dieses Gusses?
Keuchend hört man Warnungsrufe
der Verzweifelten am Deiche.
Säcke fliegen, Stuf’ um Stufe,
gegen böser Mächte Willkür,
doch nichts macht, daß man ihr weiche.
Frauen, Greise, Kinder eilen
sich zu retten auf die Höhe,
während auf den Dämmen weilen
todesmutige Bewohner,
aber wehe, wehe, wehe…
Schon entstehen erste Brüche
an des Deiches weicher Krone.
Schrille Schreie, heisere Flüche
gehen unter in dem Brausen
wilder Fluten. Wie zum Hohne
reißen Wassers Urgewalten
alles Menschenwerk hernieder.
Was vorzeiten unsere Alten
abgetrotzt der Stromestiefe,
holt Natur sich alles wieder.
Hüten solln sich Menschenkinder
vor der Hybris, Menschenwissen.
Es gibt viele Überwinder,
fordern Blutes hohe Zinsen,
ist das heilige Band zerrissen.
©8/1997 Rolf-Dieter Spann
Aufdringliche Bekanntschaft
Zur Mittagspause, im Goldenen Schwan,
wollte ich ein wenig verschnaufen;
trank mein Bier, aß ein Kotelett, nebenan
stand sie am Tresen beim Saufen.
Sie flachste herüber, ganz ungeniert
und sagte, sie heiße Christine.
Am liebsten wäre ich retiriert,
doch zeigte ich ihr gute Miene.
Prompt kam sie zum Tisch, mit tiefem Blick
versuchte sie mich anzumachen.
Wie sie mich so angrinste, hübsch und nicht dick,
musste ich ebenfalls lachen.
Nach ihrem zweiten, dritten Bier,
die Zunge wurde schon schwerer, –
oder waren es doch schon vier? –
Mein Bierglas wurde nicht leerer.
Mit einem traurigen Unterton
in ihrer besoffenen Stimme, –
sie schwankte leicht im Sitzen schon –
und lallt’, dass ihr Kerl sie vertrimme.
Ich sei aber anders, ein Mann mit Gefühl,
bei mir fühle sie sich gleich besser.
Mir wurde es allmählich schwül,
die Blondine wurd' immer kesser:
Heut habe sie auch noch den Job verloren,
ihr Exmann zahl’ nicht für die Kinder.
Warum gerade sie zum Unglück geboren,
und was noch am Tode sie hinder’?
Ich dachte, die macht sicher jeden an,
um ein paar Mark abzuzocken.
Dafür bin ich nicht der richtige Mann,
die soll einen Dümmeren locken.
Sie ging zur Toilette und ich eilig hinaus, –
was scheren mich fremde Probleme? –
Ich spendete selber mir Applaus
und fragte mich, ob die sich schäme.
Schon am nächsten Tag auf dem Titelbild
in unserer heimischen Presse
lag ‘ne blonde Frau, in ein Tuch gehüllt.
Ein Bild, das ich niemals vergesse.
Jetzt denke ich immer wieder daran,
ob sie es wohl war, die gesprungen.
Vielleicht hatte ich ihr auch Unrecht getan,
von Vorurteilen durchdrungen.
Ich gehe jetzt oft in den Goldenen Schwan,
trink mein Bier, ess’ ein Kotelett, nebenan
stehen Männer am Tresen und saufen,
politisieren und raufen.
©10/1998 Rolf-Dieter Spann
Der Floh im Ohr
Dreizehn Jahre alt war Christian,
zurückhaltend, schüchtern, angepasst,
bis ihm jemand vom fahrenden Volk
einen kleinen Floh
ins Ohr setzte.
Bärtig, schwarz , mit Filzhut
kam der Fremde daher,
lockte mit Ideen und Träumen
und seinem geheimnisvoll
verschlossenen Bauchladen.
Fortune und Liberté stand in geschmückten
Buchstaben auf dem Deckel.
Daneben ein Segelboot in Lack,
an den Seiten Bilder
aus fernen Ländern.
„Was hast du denn darin?“,
fragte voll kindlicher Neugier,
mit Blick auf den bunten Kasten,
der aufgeschossene
junge Mann.
„Die Freiheit und ihren Blutzoll“,
kam die Antwort versonnen.
„Einen Zirkus, die ganze Welt,
das Glück und seinen Preis.“
„Darf ich das mal sehen?“
Lächelnd zeigte der fremde Mann
seine Künstler und Requisiten
und wusste, dass er gerade
einen neuen Menschen
mit seiner Magie verwandelte.
Sieben kleine Flöhe, denen
er seinen entblößten
Unterarm feilbot,
sprangen fröhlich heraus,
auf seine nackte Haut.
Kleine Kutschen, Gewichte, ein Hochseil,
Karussell und Mini-Geschirre,
sowie als weiße Manege
ein seidenes Tuch,
lagen noch im Kasten.
„Mit solch treuen Freunden
kommst du immer gut durch.
Sie trinken zwar etwas Blut,
das du verschmerzt,
aber sie ernähren dich.
Sieh mal, welche Kräfte
ein Floh entwickeln kann.
Er zieht selbst schwere Lasten
zu aller Belustigung,
und macht Kunststücke.
Einer dreht schnell im Kreise
das Karussell mit Zinnfiguren,
wenn du ihn nur bittest,
doch nicht unter Zwang.
Er ist Artist!
Die alte Sophia tanzt sogar
mit Gewichten über das Hochseil
und springt aus dem Stand
einen Salto mortale.
Sie ist die Weiseste.
Die Weisheit macht selbst Schwache stark,
setzen sie ihre Kraft vernünftig ein.
Frage niemanden nach deinem Weg,
sondern finde ihn.
Das macht dich frei.
Dieser Floh ist Justitia, die Blinde,
sie balanciert den Wagen,
wie auch das Zugpferd
auf der Waage,
ganz ohne Netz.
Die Gerechtigkeit verhindert das Straucheln,
verleiht Gleichgewicht und Kraft,
sodass du auch in Dunkelheit
und den Stürmen des Lebens
dein Ziel nicht verfehlst.
Philia ist eine Künstlerin mit Herz,
sie ist mitfühlend und saugt
mein Blut ganz behutsam.
Sie denkt stets an mich
und was mich freut.
Wenn Gerechtigkeit und Weisheit
dich lenken, vergiss nicht,
die Liebe in alle Entscheidungen
mildernd einzubeziehen.
So schaffst und verspürst du Glück.“
„Tut es denn nicht weh,
wenn die Flöhe dich beißen?“
„Denkst du, dass es Glück und Freiheit
ohne ein bisschen Schmerz
und Blutvergießen gibt?“
„Kannst du mir denn sagen,
woher ich einen Floh
wie diese wohl bekomme?“
„Wenn du das wirklich willst,
bedenke den Preis…
Ich schenke dir Prudentia,
sie lehrt dich alle Dinge.“ –
Und setzte den Floh in sein Ohr,
wo er wispernd
den Jungen unterrichtete.
Christian dankte mit Freuden
und lief gleich nach Hause.
Eltern, Lehrer und Mitschüler
bemerkten an ihm gleich
große Veränderungen.
Von nun an hatte er eine
eigene Meinung und Ziele und
machte sich frei von äußeren Zwängen.
Sein Geheimnis im Ohr
behielt er für sich.
©7/1998 Rolf-Dieter Spann
Die Zeit ist reif...
oder: jetzt die Zukunft bauen
Die Zeit ist reif, um zu bedenken,
ob unser Weg zum Ziele führt.
Die Zeit ist reif, den Schritt zu lenken,
abzulegen, was uns schnürt.
Die Zeit ist reif, um aufzumucken
gegen Zeitgeist oder Trend.
Die Zeit ist reif, nicht nur zu schlucken,
hinauszuschreien, was man kennt.
Die Zeit ist reif, Hunger zu sehen,
mit sattem Bauch die Not zu spürn.
Die Zeit ist reif, um fortzugehen,
solang noch Schmerzen Herzen rührn.
Die Zeit ist reif, endlich zu sagen,
was ungenannt im Raume hängt.
Die Zeit ist reif, endlich zu wagen,
was unser Herz seit langem drängt.
Die Zeit ist reif, hervorzuheben,
was wahrhaft, gut ist – offenbar.
Die Zeit ist reif, zu überleben
mit Freunden, einer großen Schar.
Die Zeit ist reif, sich zu vergeben,
denn auch wir stehen schon am Tor.
Die Zeit ist reif, das Glas zu heben,
zu jubeln in der Andacht Chor.
Die Zeit ist reif, sich zu umarmen,
sich Mut zu sprechen in der Not.
Die Zeit ist reif, sich zu erbarmen,
das Dach zu teilen und das Brot.
Die Zeit ist reif, um Mensch zu werden.
Eitelkeiten stellt hint’an.
Die Zeit ist reif, ein Volk zu werden,
ich hoff, die Zeit wird nicht vertan.
©6/1996 Rolf-Dieter Spann
2. Tierische Gedichte
Ambivalenz
Ein Hund geht mit der Frau spazieren,
zwei Beine diese, er auf vieren.
So schlendern sie, stolz promenierend,
in teurem Outfit provozierend,
die Straße rauf und dann zur Mitte,
nach eingefleischter Abendsitte.
Jetzt öffnet sich das Ecklokal.
Die Frau pikiert sich und wird fahl.
Erst kommt ein Köter, dann ein Mann,
der nicht mehr gerade gehen kann.
„Die Abendluft“, schwärmt er verdutzt,
„ist ja so rein, fast unbenutzt“.
Sein Mischling, der das Weibchen wittert,
an seinen hohlen Flanken zittert,
erhebt sich gierig auf zwei Beine
und zerrt an Herrchens langer Leine;
wonach der seinen festen Stand
vermeindlich nur gleich wiederfand.
Schon liegt er unvermutet lang,
dieweil der Köter vorwärts sprang.
Nach ein paar Sätzen steht er hechelnd,
die Dame mit dem Schirme fächelt,
wodurch der Rüde, liebesfest,
sich leider nicht vertreiben lässt.
Er schnuppert vorne, schnuppert hinten,
dem Schirme ausweichend durch Finten.
Die so bedrängte Hundedame
signalisiert: ihr Stolz erlahme,
wonach die Frau in ihrer Not
die Haltung zu verlieren droht.
Ein kurzer Ruck noch und alsbald
verliert dazu sie auch den Halt.
Die Hunde nutzen unbeleint
die Gunst der Stunde, und der Feind
der so verpönten andern Rasse –
bei Menschen würd man sagen Klasse –
wird nicht mehr dünkelhaft verschmäht,
im Dunstkreis Sexualität.
©8/1997 Rolf-Dieter Spann
Das Geschenk
Mein Kater fängt im Garten Mäuse,
nach Katzenart verspielt und schlau;
die trägt er dann in das Gehäuse
und schenkt sie stolz gleich meiner Frau.
©6/2001 Rolf-Dieter Spann
Blacky
Des Menschen allerbester Freund
das ist und bleibt die Hundeseele,
die ahnt, was seinem Menschen fehle,
wenn der im Kummer einmal weint.
Allein zu sein, das ist oft schwer,
trotz Arbeitsstreß in mancher Stunde.
Da reifte mir das Bild vom Hunde
als Hausgenosse, mehr und mehr.
Er sollte klein sein, etwas frech,
ein ganzer Kerl mit großem Herzen,
mit dem ich balgen kann und scherzen
und wenn ich einsam bin, dann sprech.
Doch wer die Wahl hat, hat die Qual.
Im Tierheim laufen zwanzig Köter
um mich herum mit viel Gezeter
und spielen „komm und fang mich mal“.
Nur einer, der ist gar nicht fein,
der will sich selbst sein Herrchen suchen,
verstand auch, mich sogleich zu buchen
und pinkelt mir ans linke Bein.
Ich akzeptiere seine Wahl.
Die Zeit vergeht und vierzehn Jahre
verfliegen wie das Blond der Haare
und ich werd langsam auch schon kahl.
Seither hab ich es nicht bereut
mich einzulassen auf die Liebe
von Mensch und Tier – ich hoff’ es bliebe
gemeinsam uns noch lange Zeit.
Das zeigt, macht jemand dir ans Bein,
bist du deshalb nicht angeschissen.
Du solltest um die Geste wissen
und nimmst sie hin, als wär es Wein.
©8/2006 Rolf-Dieter Spann
Der Gier-Affe
Von allem, was im Busche fleucht,
durchs Dickicht keucht,
auf Bäumen kräucht,
ist meistgemieden, weil er gaffe,
der schnatterhafte Wald-Gier-Affe.
Wenn er die gelb verfärbten Zähne
nur etwas öffnet – seis, er gähne –
verordnet man ihm Quarantäne
und ignoriert ihn, wenn er spricht,
was ihn, auf Austausch stets erpicht,
in Rage bringt – es pocht die Vene.
Durch diesen Umstand deprimiert,
weil er doch wirklich niemals giert,
besinnt er sich auf eine Waffe
und nennt sich fortan nur noch Affe.
©8/2000 Rolf-Dieter Spann
Der Kampfhund
Ein Kampfhund ist, wer krumme Beine
und eine große Schnauze zeigt.
So ähnelt er, wie ich hier meine,
dem Menschen vis à vis der Leine,
von dem des Sängers Liedgut schweigt.
Beim Hund macht nicht der breite Kiefer
das Böse seines Wesens aus.
Was ihn herabzieht, immer tiefer,
zum Mordgesellen, Ungeziefer,
das ist der Mensch aus schlechtem Haus.
So gibt es leider auch kein Ende,
wenn einmal jeder Hund kastriert.
Wenn jeder Hund einmal verschwände,
dann fänden sich gewiss behende
entmenschte Beißer, ungeniert.
©12/1999 Rolf-Dieter Spann
Der Schlächter
Im Dunkeln steht der Schlächter.
Er ist kein Kostverächter
Und lauert auf Beute,
Nicht nur wegen der Häute,
Zum Messer greift gierig der Schlächter.
Da regt sich was im Schatten!
Zwei dicke haarige Ratten
Trippeln ins Licht.
Noch wittern sie nicht,
Der Schlächter steht im Schatten.
Den Stahl fest in den Fingern
Schnappt er nach diesen Dingern.
Ein Stich und ein Schrei –
Schon ist es vorbei
Mit den Ratten, den häßlichen Dingern.
Er packt sie an ihren Schwänzen.
Zuende ists mit den Tänzen.
Hinab in den Sack
Mit dem blutigen Pack.
Die schweißigen Finger glänzen.
Nun schnell zu seinem Hause
Voll Schuld ersehnt er die Brause.
So schleicht er sich fort
Von dem gräßlichen Ort,
Man erwartet ihn schon zu Hause.
Es steht schon an der Türe
In der linken Hand die Fritüre
Der Koch vom Lokal
Zum „Großen Wall“
Und öffnet dem Schlächter die Türe.
„Wo walst du denn so lange?“
Fragt der Koch ihn bange.
„Del Gast ist gleich folt,
Hat das Lammfleisch gewollt,
Abel du blauchtest viel zu lange.“
©8/1996 Rolf-Dieter Spann
